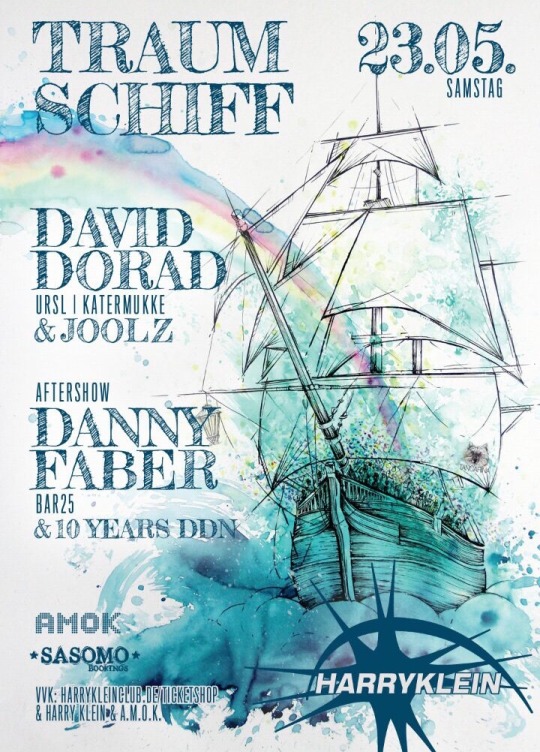Wenn es einen Musikstil des 21. Jahrhunderts gibt, dann ist es die elektronische Musik. Normalerweise sind die Beats computergeneriert und werden nie live mit Instrumenten gespielt. Bei dem Münchener Techno-Duo Isarkind ist das anders…
Bei solchen Erinnerungen freuen sich die heute weit über 30-Jährigen: die Isar-Partys in München. Als das mit dem Techno als neue Musikrichtung anfing, zu Zeiten, als München noch eine Sperrstunde hatte, entwickelte sich eine Szene außerhalb der bestehenden oder neu entstehenden Clubs: Partys in Unterführungen, in verlassenen Gebäuden oder eben gleich ganz unter freiem Himmel an der Isar. Heute wirkt das hier alles organisierter – und natürlich ist elektronische Tanzmusik in all ihren Facetten einer viel breiteren Masse zugänglich geworden als Mitte der Neunzigerjahre. Doch in ein paar Münchner Projekten setzt sich diese Kombination aus anarchistischer Raum-Ergreifung und elektronischer Musik fort. Seit 2010 etwa gibt es die Gruppe Isar Bass. Mit Bollerwagen, Soundanlage und Bierkästen kehrten die an die Isar zurück, um dort Partys zu veranstalten, die sich der inzwischen stark kommerzialisierten Clubszene entziehen.
Das Duo Isarkind trägt den Fluss der Stadt hingegen eher als eine Art Motto im Namen, auch wenn sie musikalisch ebenfalls der elektronischen Musik und dem Techno nahestehen. Nur verzichten sie auf dort sonst übliche Insignien: keine Turntables, keine Computer und keine Synthesizer. Dafür eine konventionelle Bandaufstellung aus Schlagzeug und Gitarre. Schlagzeuger Michael Steinberger und Gitarrist Christian Pfaffinger spielen damit fließenden Analog-Ambient. „Clubsound mit Schlagzeug und Gitarre zu spielen, ist deshalb so spannend, weil wir den Sound live jedes Mal neu formen können“, erklären sie. Die Instrumente seien „vielschichtiger als elektronische Sounds, sie schwingen anders und zwar bei jedem Anschlag“.
Es ist erstaunlich, wie selten es solche Bands gibt. Elektronische Musik ist gegenwärtig prägend wie kaum ein anderer Musikstil. Trotzdem kommt fast niemand auf die Idee, das mit Live-Instrumenten umzusetzen. Wie sehr das knallen kann, zeigte Mitte der Nullerjahre zuletzt die Münchner Band Pollyester. Isarkind sind ein bisschen zugänglicher und lieblicher als die frühen Pollyester. Die Musik ist wolkiger, sie spielen den Techno nicht nur nach, sondern formen diese Musik weiter. Das mag auch an der klassischen Band-Erfahrung der beiden liegen: Im niederbayerischen Hinterland aufgewachsen, haben sie in diversen Punk- und Alternative-Bands gespielt.
Im Sommer 2017 erschien das selbstbetitelte Debüt-Album. Elf Tracks zwischen treibenden Sechzehntel-Noten und pulsierenden Bass-Drum-Schlägen am Schlagzeug und beinahe psychedelischen Gitarren-Pickings. „Klar knallt das nicht so derbe wie ein High-End-Electro-Beat“, geben sie zu, aber ihnen ginge es sowieso viel mehr um „Atmosphäre und Dynamik“. Dabei entsteht etwas Spannendes. Denn in dieser Musik liegt im Hören plötzlich die Verbindung von Postrock und modularer, technoider Musik offen. Die Gitarren, die Harmonien und die monotonen Kompositionen kennen beide Genres. Im Techno wird das nur oft überdeckt von der Härte der Drumcomputer und den künstlichen Sinusklängen der Synthesizer. Bei Isarkind aber, wo immer hörbar bleibt, dass hier ein echtes Schlagzeug spielt und Metallsaiten schwingen, ist die Nähe plötzlich deutlich hörbar. Auch weil das Duo weniger auf stampfenden Techno, sondern mehr auf Ambient setzt.
Foto: Flo Strigl
Text: Rita Argauer