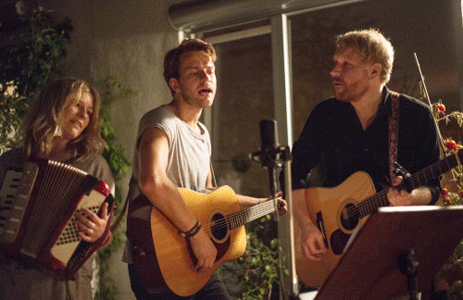Ein Unfall ändert für Marko Baader, 21, alles. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, leidet unter großen Einschränkungen. Sogar ein kleiner Tagesausflug wird zu einer logistischen Herausforderung. Das wollte Marko ändern und gründete eine Autovermietung für Rollstuhlfahrer
München – Den 2. April 2011 wird Marko Baader, 21, nie vergessen. Er feiert mit seinen Freunden und will schnell zur Tankstelle, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er stolpert und stürzt mit dem Kopf gegen eine Mauer. Dabei bricht er sich drei Halswirbel.
Als er aufwacht, realisiert er nur langsam, was mit ihm geschehen ist. Seine Freunde reihen sich um sein Bett, in ihren Augen stehen Tränen. Marko glaubt erst, es sei ein Albtraum. Er will sprechen, aber daran hindert ihn ein Luftröhrenschnitt. Er kann nichts sagen, nicht fragen, als er erfährt, dass er von nun an querschnittsgelähmt ist.
Marko liegt wochenlang auf der Intensivstation, schließlich kommt er in die Reha. Er lernt wieder, einen Arm zu heben, aber der restliche Körper bleibt gelähmt. Marko fällt in tiefe Depressionen. Er will nicht mehr leben.
Währenddessen versucht sein Vater, Joachim Baader, einen elektrischen Rollstuhl aufzutreiben. Die Vereinbarung mit der Kasse sieht dafür zunächst keine finanziellen Leistungen vor. Es heißt, die Familie müsse die immensen Kosten selbst übernehmen. Sie starten Spendenaktionen, veranstalten Benefizkonzerte, verteilen Flyer, das Bayerische Fernsehen schaltet sich ein. Am Ende zahlt die Kasse doch einen Großteil und es kommt viel mehr Geld zusammen als erhofft.
„Wir wollten der Gesellschaft etwas zurückgeben“ sagt Joachim Baader. So kauften er und Marko von dem finanziellen Überschuss einen Bus und gründeten die wheels4wheels, eine Autovermietung für Rollstuhlfahrer.
An den Rollstuhl gebunden sind Menschen mit Behinderung enorm eingeschränkt: Mobilitätspauschalen ermöglichen es zwar, zwischen Wohngruppe und Familie hin und her zu pendeln. Und im Krankheitsfall zahlt die Kasse ein Taxi zum Arzt. Aber für einen Tagesausflug mit Freunden, raus in die Natur, gibt es kaum Kapazitäten. Da kommt das sogenannte PlegiCar von wheels4wheels gerade richtig. Sein Gehäuse birgt Platz für mehrere Rollstühle, verfügt über eine spezielle Bodenverankerung und ist mit einer hydraulischen Hebebühne ausgestattet. „Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute aus ihren vier Wänden rauskommen“, finden Marko und Joachim Baader, „dass sie merken, sie sind noch am Leben!“
Doch da die Miete für solch einen Bus sehr teuer ist, haben sich Vater und Sohn außerdem für eine Gemeinnützigkeit eingesetzt. Inzwischen gibt es zwei Busse, die aber noch nicht abgezahlt sind. Bald kommt vielleicht ein dritter Bus hinzu. Spendengelder können dabei helfen, die Kosten zu deckeln und die Fahrten günstiger anzubieten.
Marko erzählt von einem Freund aus seiner Wohngruppe, der an Muskeldystrophie leidet und 24 Stunden am Tag beatmet werden muss. wheels4wheels erfüllte ihm vor zwei Jahren noch einen lang ersehnten Traum. Begleitet von Pflegern und Familie, fuhr er ins Disneyland nach Paris. Aber das PlegiCar soll nicht nur Menschen mit Behinderung dienen. Marko und sein Vater wollen auch Senioren im Rollstuhl ermöglichen, „mit Nahestehenden auf Entdeckungsreise zu gehen“.
Inzwischen war der Bus mit seinen Gästen schon in Brüssel, London, in Kroatien und Österreich. Marko ist begeistert. Denn der Bus bietet viel mehr Freiheiten: „Es gibt Firmen, die Urlaubsreisen anbieten, aber da gibt es einen ewigen Vorlauf. Und du bist immer in der Gruppe. Das ist wenig individuell. Du machst, was die Betreuer sagen.“
Und Vorschriften mochte Marko noch nie. Seine Freunde und er fahren mit dem Bus auf Raves oder an den Ammersee, wo sie bis spät nachts am Kaminfeuer sitzen. Jetzt planen sie eine Reise nach Holland. Oder nach Prag. Marko strahlt. Die Lebensfreude hat ihn wieder. Dazu leistet der Bus einen gehörigen Beitrag. Vor allem aber sind es die Spenden für die Fahrten, die Menschen mit Behinderung sozialen Anschluss garantieren, Horizonte weiten und Wege ebnen können, hin zum Abenteuer Leben.
Von Susanne Brandl
Foto: J. Baader