Das Start-up flyla vertreibt im Internet vergünstigte Flugtickets für Studenten. Im August wird es europäische Fluge für bis 70 Prozent günstiger geben.
München Lebt. Menschen und mehr.
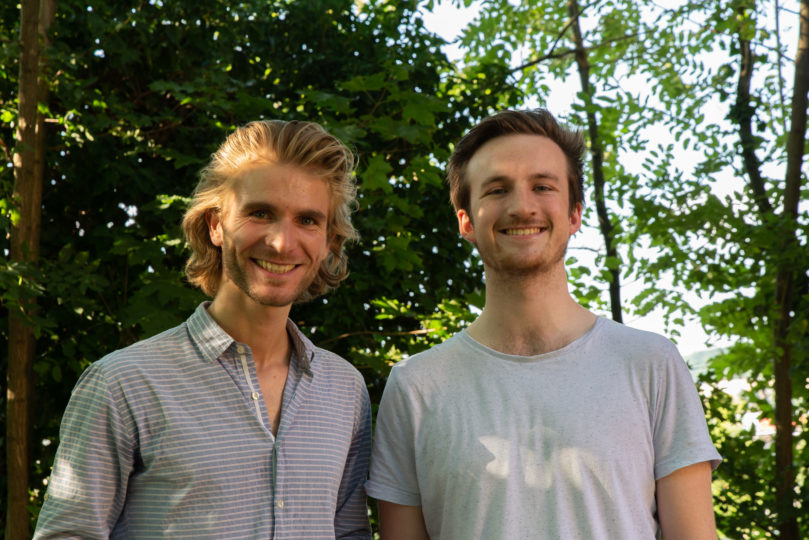
Das Start-up flyla vertreibt im Internet vergünstigte Flugtickets für Studenten. Im August wird es europäische Fluge für bis 70 Prozent günstiger geben.

Lukas Bauer und Nikolas Lediger machen Videos über Flugzeuge. Ihrem YouTube-Kanal folgen mehr als 34000 Menschen. Beide spielen mit dem Gedanken, ihren späteren Beruf mit dem Hobby zu verbinden.

Noah Agha Schüler, 21, ist Reisebloggerin. 18 000 Follower hat sie bei Instagram. Auf ihrem Blog “noahamywhite” berichtet sie nicht nur über das Reisen, sondern auch über Mode und Kulinarisches. Als Influencerin zeigt sie nicht nur hübsche Fotos auf Instagram, sondern vermittelt zusätzlich ein Bewusstsein für Interkulturelles. Sie selbst ist in München mit mehreren Kulturen aufgewachsen.
SZ: Wo fühlt sich eine Reisebloggerin zu Hause?
Noah Agha Schüler: Überall. Ob in München oder Teheran. Eine besondere Verbindung habe ich zu Rio. Dort bin ich geboren.
Also schon früh herumgekommen. Ist so auch die Idee zum Blog entstanden?
Seit ungefähr zweieinhalb Jahren reise ich regelmäßig. Irgendwann habe ich gesehen, dass auf Instagram die Kombination von Bild und Text von Reisen gut ankommt.
Und offenbar auch die Themen Mode und Essen, über die Du auch schreibst.
In jedem Land gibt es unterschiedliches Essen, verschiedene Mode und Arten sich zu kleiden. Auch diese Seiten zeige ich, weil jedes Land da seine Eigenarten hat.
Was zum Beispiel zeigst Du?
Im Iran zum Beispiel, dem Land, aus dem mein Vater stammt, müssen sich Frauen in der Öffentlichkeit ganz anders kleiden, als in europäischen Ländern. Also zeige ich das auch auf meinem Instagram-Profil und thematisiere das auf dem Blog. Sie müssen ein Kopftuch tragen, was aber nicht bedeutet, dass sie automatisch weniger offen sind als Mädchen bei uns.
Trotzdem müssen die Frauen dort strengen Regeln folgen.
Man sieht daran, dass sie nicht so frei sein können. Viele junge Menschen wollen das Land auch verlassen. Einmal wollte ich im Iran ein Foto mit meiner Cousine machen, vor einer Touristenattraktion. Dabei ist mir das Kopftuch runtergerutscht. Sofort kam ein Polizist zu mir, aber es ging alles gut. Mir ist bewusst, dass man dort für Regelverstöße bestraft wird oder sogar ins Gefängnis kommt. Ich möchte dennoch zeigen, dass sich eine Reise in den Iran für junge Menschen lohnt. Es ist nicht alles negativ und man kann sehr viel über die Menschen und die dortige Kultur lernen.
Was denn?
Viele denken bei Iran sofort an den Islam. Im Iran leben auch andere religiöse Gruppen, etwa Juden. Es gibt Synagogen. Das wissen wenige. Sogar mein Geschichtslehrer wusste das nicht.
Deine Mutter ist Brasilianerin und jüdisch. Hat das Jüdische dich geprägt?
Meine Geschwister und ich bekamen Hebräisch-Unterricht, wir haben jüdische Feste gefeiert und machen das heute noch. Wenn ich an einen Ort reise, gehe ich aber überall hin. In Kirchen, Moscheen und Synagogen. Außerdem bin ich ja mit drei Kulturen aufgewachsen: Mein Vater hat Farsi mit mir gesprochen, meine Mutter brasilianisches Portugiesisch und in München bin ich groß geworden.
Wie finanzierst Du dir deine Reisen?
Manchmal kooperiere ich mit Reiseveranstaltern oder Hotels. Ich darf dann in den Hotels übernachten, wenn ich etwas darüber poste oder schreibe.
In Hotels bekommt man aber doch nicht viel von der einheimischen Kultur mit.
Meistens versuche ich zusätzlich bei anderen Familien vor Ort unterzukommen. So bekomme ich viel mehr mit von den Ländern und den Menschen, die dort leben.
Wie war es für dich, mit den Kulturen deiner Eltern in Deutschland aufzuwachsen?
Nicht immer einfach. Besonders in der Schule nicht, weil mir meine Eltern nicht so gut helfen konnten, da es manchmal sprachliche Probleme gab. Zu Hause haben wir kaum Deutsch gesprochen. Ich hatte zum Glück Nachhilfe.
War das komisch?
Etwas schon, aber mittlerweile hat sich das geändert. Die Leute gehen ja heute größtenteils sehr gut damit um, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat. Ich möchte trotzdem, dass die Leute wissen: Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die mit mehreren Sprachen und Kulturen aufwachsen und ich mag es, mich mit anderen darüber auszutauschen. Deshalb auch die Reisen und der Blog.
Interview: Ornella Cosenza
Foto: Alex Seifert

Unsere Autorin hat die Schnauze voll. Von Leuten, die immer gezwungenermaßen eine Nummer cooler sein müssen als der Rest der Welt, und bei denen Urlaub plötzlich nur noch
„Reisen“ genannt wird.
Vorlesungsfreie Zeit ist Urlaubszeit. Da machen sich dann alle auf den Weg. Und egal wohin es geht und ob man stinkreich oder super hip und möchtegern alternativ ist, egal in welchen Kreisen man verkehrt: es gibt immer diese eine Sorte Mensch, die einfach immer cooler ist als du. Und dieser Mensch drückt’s dir dann so richtig rein! „Ich bin nicht im Urlaub, ich bin auf Reisen!“ oder „Wirklich? Nur der Kurztrip nach Spanien? Ich bin zwei Monate in Argentinien. Ohne Handy, ohne alles. Ich muss weg von all dem Mainstream.“ Und noch was von der Sorte: „Mensch, die Klausuren waren so anstrengend, ich fahr mit meinem Freund über’s Wochenende ins Spa. Mein Rücken ist meeeegaa verspannt.“ Schön für euch alle! Toll! Ist ja auch meeeeega entspannt, wenn ihr jedem erst mal beweisen müsst, dass euer Urlaub, pardon, eure Reise so viel toller ist. Wir haben’s verstanden.

Ob auf der Fahrradstange oder einem Tuk-Tuk, mit vielen schönen Erlebnissen, Glück und einmal mit Todesangst – Nicola Deska ist von London nach Australien getrampt, an ihrem Lieblingsort will sie nun ein Café eröffnen.
Acht Autos sind in vier Stunden vorbeigekommen – und sie ist keinen Meter weiter. Nicola, eine junge Frau mit langem braunem Haar, tätowierter Haut und großen braunen Augen, ist irgendwann nur noch frustriert. Die Chinesen sind zwar unglaublich hilfsbereit, aber wollen scheinbar einfach nicht verstehen, wo sie hin möchte. Schließlich gibt sie auf und fährt mit dem Bus zur richtigen Autobahnauffahrt – in der Hoffnung, dass sie jemand von dort mitnimmt und nicht plötzlich einfach umdreht und sie weitere vier Stunden im Kreis um die immer selbe chinesische Millionenstadt fahren muss.
Nicola Deska, 28, kann viele solcher Anekdoten erzählen. Während der acht Monate, die sie von London in England bis nach Byron Bay in Australien durch 20 Länder getrampt ist, hat sie lustige, absurde, frustrierende und traurige Geschichten erlebt, wie sie das Leben schreibt.
Schon seit sie 14 ist, reist Nicola regelmäßig alleine. Länger an einem Ort gehalten hat es sie seitdem nie. „London habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben mein Zuhause genannt“, sagt Nicola.
Geboren ist sie in München. Doch dort habe sie sich schon als Jugendliche nie so wirklich heimisch gefühlt. „München war für mich immer ein Ort, der mir genau gezeigt hat, was ich im Leben nicht möchte“, sagt sie. Hier werde man auf Ausbildung, Netzwerk und Vermögen reduziert. Nur wegen ihrer Mutter und engen Freunden komme sie ab und zu noch zu Besuch. Länger hier gelebt hat sie nicht, seit sie mit 17 die Schule geschmissen hat, um „abzuhauen“.
Seitdem packt Nicola regelmäßig ihren Rucksack und lernt vom Leben das, was ihr kein Lehrer je hätte vermitteln können – da ist sie sich sicher. Das Geld, das sie zum Reisen braucht, verdient Nicola sich durch diverse Jobs in der Gastronomie. Bewusst hat sie sich für diesen Berufszweig entschieden, denn Restaurants und Bars, in denen man arbeiten kann, gibt es überall auf der Welt.
Von England nach Australien. In wie viele Autos sie gestiegen ist, weiß die junge Frau nicht mehr. Ab und zu musste sie mit der U-Bahn an die Stadtgrenze fahren; und einige Male haben Menschen sie zwar mitgenommen, wollten aber am Ende doch Geld dafür. Den Rest der Zeit hat sie sich hauptsächlich von Autos, aber auch Trucks, Fähren, fahrenden Essensständen und Tuk-Tuks mitnehmen lassen – völlig umsonst, wie das beim Trampen üblich ist. In Thailand habe ein Mann sie sogar auf seinem Fahrrad mitgenommen. „Ich saß vorne auf der Lenkradstange und meinen Rucksack hat er auf den Gepäckträger geklemmt“, sagt Nicola und lacht bei dem Gedanken daran.
Trampen. Eine Art zu Reisen, die in Deutschland vor allem in den 70er Jahren weit verbreitet war und dann durch zuverlässigere und sicherere Reisemöglichkeiten wie Mitfahrzentralen und Fernbusse kurzzeitig verdrängt wurde. Seit Anfang der 2000er Jahre scheint der Trend jedoch wiederbelebt worden zu sein. Vor allem junge Menschen haben das Trampen neu für sich entdeckt. Es ist die umweltfreundliche Alternative für jene, die nicht aufs Reisen verzichten wollen, aber der Umwelt zuliebe nicht fliegen wollen und sich, ähnlich wie beim Carsharing, ein Auto teilen, statt sich selbst eines zu kaufen.
In Deutschland sei es sehr einfach zu trampen, weil die Infrastruktur sehr gut ausgebaut sei, sagt Nicola. In Osteuropa sei Fahren per Anhalter ebenfalls seit jeher eine gängige Art zu Reisen, Menschen in Asien sei das Konzept allerdings größtenteils völlig fremd. Wie vielen anderen Trampern geht es Nicola aber nicht in erster Linie darum, kostenlos zu reisen: Im Gegenzug für die Mitfahrgelegenheit habe sie für die Menschen, die sie mitgenommen haben oder für Couchsurfer, die sie bei sich übernachten haben lassen, gekocht und dafür häufig mehr Geld ausgegeben, als sie für ein Zugticket bezahlt hätte, sagt sie. Es ist der Austausch, der ihr gefällt. „Die tun etwas für mich, ich tue etwas für die – so schließt sich der Kreis“, lautet ihre Philosophie. Genauso handhabt sie das auch bei der Suche nach einem Schlafplatz: Sie hilft in Hostels beim Saubermachen oder auf Bauernhöfen bei der Ernte und bekommt dafür Essen und ein Bett. Es ist ein Geben und ein Nehmen – das für viele Tramper zum Lifestyle geworden ist.
Eine Frau allein auf Reisen, das klingt für viele nach Gefahr. Und obwohl Nicola, die ein goldenes Septum in der Nase trägt und deren Arme und Beine mit Tattoos übersät sind, nicht wie eine Frau aussieht, die sich nicht zu helfen weiß, hat sie doch einige Regeln beim Reisen, die sie immer befolgt. Regel Nummer eins: Vertraue immer deinem Bauchgefühl. „Wenn ich merke, dass mich ein Typ erst mal von oben bis unten mustert, dann steige ich gar nicht erst ein“, sagt sie. Außerdem würde sie niemals betrunken oder unter Drogeneinfluss trampen. Länder wie Finnland, Russland, Malaysia, China und Kambodscha hat Nicola auf dem Landweg durchquert – ohne ein einziges Mal in Gefahr gewesen zu sein. „Es ist unglaublich, wie gut die meisten Menschen sind“, sagt Nicola.
Natürlich hat Nicola aber auch schon mal Angst gehabt, Todesangst. Sie wartet eines Abends auf einer Landstraße in Lappland auf eine Mitfahrgelegenheit, knietief steht sie im Schnee. Es wird schon langsam dunkel, als endlich ein Auto anhält. Ein großer Mann mit ernstem Gesichtsausdruck steigt aus und nimmt, ohne auch nur Hallo zu sagen, ihren Rucksack und wirft ihn ins Auto. Nicola hat nur wenige Sekunden, um zu entscheiden, ob sie einsteigen soll. Sie wägt ihre Möglichkeiten ab: Entweder im Schnee erfrieren oder mit dem Mann mitfahren und hoffen, dass alles gut ausgeht. Sie steigt ein. Per Translator-App versucht sie dem Mann zu erklären, dass sie an der nächsten Tankstelle raus gelassen werden will.
Die Tankstelle kommt, aber der Mann fährt weiter. Nicola malt sich die verschiedensten Horrorszenarien aus. Als das Auto schließlich anhält, stehen sie vor einem Haus mitten im Wald. In der Tür stehen eine Frau, ein kleines Kind und ein Hundewelpe. Sie kann duschen und bekommt etwas zu essen und schließlich fährt sie der Mann sogar mitten in der Nacht in die 200 Kilometer entfernte Stadt Turku – einfach so. „Der Mann war einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe“, sagt Nicola. Damals hatte sie Angst, heute weiß sie, dass diese Angst unbegründet war – und dass sie viel Glück gehabt hat.
Wer alleine reist, der lernt aber nicht nur seine Mitmenschen besser kennen, sondern vor allem sich selbst. „Ich habe gelernt, mein eigener bester Freund zu sein“, sagt sie, und als sie lacht, klingt es wie ein Glucksen. Statt, wie früher, jeden Tag nach der Arbeit noch mit ihren Kollegen feiern zu gehen, gehe sie heute lieber alleine im Wald spazieren, sagt Nicola.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie nicht mehr gerne unter Menschen ist – im Gegenteil. Durch ihre Reisen habe sie wunderbare Menschen überall auf der Welt kennengelernt, sagt sie. Natürlich ist es nicht immer leicht, über die Distanz den Kontakt zu halten, aber das ist für Nicola eher eine Frage des Willens. „Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Freundschaften unter dem Reisen leiden“, sagt sie. Alle Menschen, die ihr nahe stünden, wüssten, dass das Reisen ein Teil von ihr sei und würden diesen Freiheitsdrang auch an ihr schätzen, sagt sie. Nicola gefällt vor allem die Idee, ihre Freunde überall auf der Welt miteinander zu verbinden. Viele ihrer Freunde haben sich über sie kennengelernt und so hat sich über die Zeit eine Art „Netz aus Freunden“ gebildet, wie sie sagt, die sich alle gegenseitig kennen und schätzen. Für Nicola ist es wie ein Sicherheitsnetz, das sie immer wieder auffängt – egal, wo auf der Welt sie gerade ist.
Das Ziel ihrer Reise, Byron Bay, hat Nicola im Juni diesen Jahres erreicht. Viele ihrer Freunde und Bekannte haben ihr von diesem Ort erzählt, ihr gesagt, der sei genau das Richtige für sie. Vorgestellt hat sie sich diesen paradiesischen Ort mit vielen, kleinen Holzhütten direkt am Strand, umgeben von blühender Natur. Genau so einen Flecken hat sie auf ihrer Reise gefunden, aber der Ort hieß nicht Byron Bay, sondern Koh Phayam, eine Insel im Westen von Thailand. Im Winter 2017 möchte sie dorthin zurückkehren und an der Stelle ein Café eröffnen. Für Nicola ideal: Die Westküste Thailands ist während der Regensaison besonders stark betroffen und so kann sie sechs Monate im Jahr dort arbeiten, sechs Monate im Jahr reisen. Für die rastlose Weltenbummlerin ein idealer Kompromiss: An dem für sie schönsten Ort der Welt kann sie zeitweise leben und gleichzeitig mit dem Café Geld für ihre nächsten Reisen ansparen.
Text: Jacqueline Lang
Foto: Marcel a Vie

Im Leben gibt es Schicksalsschläge, die man nur schwer verarbeitet. Genau in solchen Zeiten ist es schön Menschen an seiner Seite zu haben, die mit einem gemeinsam trauern. Das schweißt zusammen.
Es ist Donnerstag Nacht und ich habe am nächsten Morgen Colloquiumsbesprechung. Ich weiß, eigentlich sollte ich im Bett liegen. Dennoch sitze ich, eingeklemmt als dritte Person auf einem 2-Mann-Sofa in der randvollen Sendlinger Jungs-WG-Küche, ein Glas Rotwein und einen Heimweg von zwei Stunden vor mir, und bekomme einen Teller Nationalgericht von irgendwo, etwas mit Kichererbsen und Fladenbrot in die Hand gedrückt.
Wir sind ungleiche Freunde, die meisten hier über fünfundzwanzig, gerade dabei, ihr Leben in den Griff zu bekommen und ich seit ein paar Wochen achtzehn, beschäftigt mit dem Abi und völlig planlos für die Zeit danach.
Ich erinnere mich gut an unsere erste richtige Begegnung. Ich bin elf, zwölf, irgendwas um den Dreh und ich habe in dieser Zeit ziemliche Probleme mit dem Schlafen, bin stundenlang wach und kann die Augen nicht schließen.
Und man kennt das ja, nachts, im Dunkeln, sind Geräusche lauter und Gerüche intensiver. Ich liege also da, alle Sinne scharfgestellt, und versuche zu schätzen, wie viele Paar Füße da in unserer Küche herumlaufen. Und wundere mich über den Geruch. Knoblauch. Ich werde sowieso nicht einschlafen, also schleiche ich mich runter, nur um mal zu lauschen und vielleicht durchs Schlüsselloch zu schauen. Natürlich werde ich entdeckt. Und stolz wie Oskar sitze ich ein paar Minuten später am Tisch, mit meinem Bruder und seinen Freunden und einem Teller Nudeln vor mir.
Es sollte mein erster von vielen Mitternachtssnacks mit ihnen sein und die Hoffnung, Schritte in der Küche zu hören und etwas zu riechen, machte das Nicht Schlafen können um so viel weniger schlimm.
Im Nachhinein würde ich es keinem übel nehmen, hätte man mich einfach wieder rausgeworfen, die kleine nervige Schwester, sieben Jahre jünger und verknallt in jeden der coolen Freunde. Ich weiß noch so genau, wie ich meinen Bruder um sie beneidet habe. Große Jungs, die Sonntag früh in unserem Wohnzimmer aufwachten, die Augen ganz verquollen und den Kater so deutlich ins Gesicht geschrieben, dass meine Mutter den Abgabetermin in der Bücherei sausen ließ, um allen Kaffee zu kochen. Große Mädchen, die auf dem Festnetz anriefen und ihn unbedingt sprechen wollten, die mit uns am Abendessen saßen und nur ganz wenig Reis aßen, und dafür viel Salat. Freunde, mit denen er klettern ging, in die Berge, feiern, spontan wegfuhr, nach Barcelona, Sardinien, Chamonix. So erwachsen, so locker. Er und seine Freunde kamen mir vor wie das Non Plus Ultra an Coolness und Reife. Ich weiß noch, wie ich meiner Mutter sagte, ich wolle auch mal solche Freunde. Freundschaft und Vertrauen sind eine seltsame Sache. Oft brauchen sie ewig in ihrer Entstehung.
Und dann kommt es manchmal von einen Tag auf den anderen. Als mein Bruder starb, da waren sie einfach da. Und mit ihnen diese Nähe. Und irgendwo auf
beiden Seiten Dankbarkeit dafür, jemanden zu haben, dem es genau so geht wie einem selbst. Sie standen weinend vor der Tür, saßen verloren in unseren Küchenstühlen, hielten Reden bei der Beerdigung und erstellten Playlists mit Musik, die uns an ihn erinnerte. Ließen sich von mir in den Arm nehmen, als ich noch nicht weinen konnte und taten später das selbe für mich. In einer Zeit,
als ich nicht wusste, wohin mit mir waren sie da. Und nahmen mich mit in ihre Welt aus ausgelatschten Kletterschuhen, Festivals und Drei Fragezeichen Hörspielen. Vor ein paar Monaten noch nannte ich sie „die Freunde von meinem Bruder“. Inzwischen sage ich einfach „Freunde“. Sie leihen mir die Ersatzschlüssel für ihre Wohnungen, für den Fall der Fälle, schmuggeln mich in Clubs und fragen mich, wo ich bleibe, wenn ich beim obligatorischen Donnerstag-Abend-Essen nicht da bin. Wir planen gemeinsam Urlaube und zicken uns an, wenn wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen. Und irgendwie ist es normal geworden, mit Menschen abzuhängen, die gerade in einem völlig anderen Lebensabschnitt stecken als ich. Weil uns etwas zusammengeschweißt hat, was den Altersunterschied überwiegt.
Ich bin kein Ersatz. Und das sind sie auch nicht. Aber ich finde meinen Bruder in ihnen und sie finden ihn in mir. Und wenn sie mich heute abends noch heimfahren, dann kommen sie manchmal noch mit rein. Auf einen Mitternachtssnack.
Text: Magdalena Siebers
Foto:
Yunus Hutterer

Essen verbindet. Gemeinsames Träumen auch. In ihrer Kolumne erzählen unsere beiden Autoren von einer ganz besonderen Küche, vollgestopft mit Gewürzen aus aller Welt und ganz viel positiver Stimmung.
Wir sind schon
ein wenig träge. Während sich die restliche Münchener Jugend in den neuesten,
abgefahrensten, teuersten und angesagtesten Clubs dieser Stadt tummelt,
entscheiden wir uns am Otto-Normal-Samstagabend – für Adams Küche. Kein Megaevent
im Blitz, keine Mondfinsternis und kein kostenloses Musikfestival können uns
umstimmen, wenn wir mal wieder richtig Bock auf Adams Küche haben. Und auf Ihn
natürlich.
Adam, der
immer schon die Wohnungstür öffnet, unmittelbar bevor man sie erreicht hat. Der
grinsende Lockenkopf empfängt uns mit einer dicken Umarmung und seinem
typischen „Naa?!“ in seiner kleinen, nach Ebenholz und sanften Gewürzen
duftenden Wohnung. Das Wohnzimmer lassen wir links liegen. Wir folgen ihm in
die kleine, meist mit Musik, Essen und Menschen prall gefüllte Küche.
Kitschige
Backformen in den verschiedensten Formen aus den verschiedensten Jahrzehnten
schmücken die Hinterwand. Die Fensterbank ist vollgestellt mit Kräutertöpfen,
auf dem Tisch steht eine Wasserkaraffe mit dem Schriftzug „Liebe“. Einmal quer
durchs Zimmer führt eine Leine, auf der seit vielen Jahren die verschiedensten
Kräuter, Chilis und undefinierbaren Naturprodukte trocknen. Wüsste man es nicht
besser, könnte man meinen, die Küche gehöre einem sesshaft gewordenen
Waldschamanen.
Soweit das
das äußere Erscheinungsbild. Das eigentlich Anziehende, der Grund warum wir beide
uns in Adams Küche noch wohler fühlen als in der Wasserbettenabteilung von Segmüller,
ist aber natürlich vor allem Adams Gesellschaft. Er ist nicht nur ein
unglaublich einfühlsamer und respektvoller Mensch mit unvergleichlichem
Gerechtigkeitssinn, dem man die merkwürdigsten Geschichten anvertrauen kann.
Adam ist für uns genialischer Gitarrenspieler, Schulbanknachbar der ersten
Stunde, unverzichtbarer Freund und Horizonterweiterer. Er liebt es, viele
Menschen um sich herum zu haben, sie zu bekochen und zu verwöhnen. Je mehr
Leute sich in seiner kleinen Wohnung versammeln, umso
fröhlicher ist er – egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ausgedehnte
stundenlange Katerfrühstücke sind genau wie hitzige Schafkopfrunden oder
gemütliche Spieleabende nirgends so schön wie bei Adam in der Küche. Sie steht
dem Raum der Wünsche in Hogwarts in nichts nach. Sie stillt unseren Drang, die
Außenwelt auszusperren und ihre Absurdität einfach mal belächeln zu können.
Zu guten
Gesprächen gesellt sich noch besseres Essen – mal aus Polen, dem Heimatland
seiner Eltern, mal international. Immer viel. Immer lecker. Außer wenn jemand
wieder die getrockneten Chilis unterschätzt und eine Pizzaparty zum
tränenreichen Schärfekontest mutiert. Und da Essen nicht alles ist, laufen im
Hintergrund CDs. Blues aus Mali. Irgendwas wie Post-Rock aus den 80ern. Oder
eine Playlist, mitgebracht von einem Roadtrip nach Polen.
Es ist aber
nicht nur ein Ort der Völlerei, der Wollust und der Exzesse. Sie ist gleichzeitig
eine Wohlfühloase, ein Ort der Einkehr und der vollkommenen Zufriedenheit. Sie
bedeutet für uns Konstanz in einer sich viel zu schnell drehenden Welt. Und ist
vielleicht sogar der Grund, warum unser Freundeskreis in zehn Jahren noch nicht
auseinandergebrochen ist.
Man kann das
durchaus als Kleister einer Freundschaft ansehen, die uns ganz bestimmt zu den
Menschen geformt hat, die wir heute sind.
Anfangs lernten wir dort Lateinvokabeln. Irgendwann wurde Liebeskummer
dort geheilt, Reisepläne geschmiedet und neue Musiker-Idole entdeckt. Als wir
noch zusammen zur Schule gingen, heckten wir Pläne für die Zeit nach dem Abitur
aus. Wir wollten alle Dasselbe – Musikkarriere machen oder zumindest
Musikjournalist werden, mit dem Bus nach Marokko fahren, die Welt erkunden und
verbessern. Die Klassiker eben. Die Realität macht einem dann doch immer einen
Strich durch die Rechnung – diese Küche übt einen seltsamen Sog auf uns aus. Dass
sich all das in einem gerade so zehn Quadratmeter großen Zimmer abspielt, macht
nichts. Denn selbst Trägheit kann wunderbar sein, ist man nur von den richtigen
Menschen umgeben.
Text: Tilman
Waldhier und Louis Seibert
Foto:
Yunus Hutterer

Reisen verändert. Nicht nur die eigene Wahrnehmung von den Dingen die einen umgeben. Auch Freundschaften, die auf einer Reise entstehen, heben sich oft von anderen ab. So ein Kennenlernen hat unsere Autorin erfahren, auf einer Reise durch Thailand
19. Dezember 2016, 10:00 Uhr, Flughafen München, Terminal 2:
Ich starre gespannt auf die Anzeigetafel der Arrivals. Die Air Canada 846
verspätet sich um eine Stunde. Ich bin aufgeregt und kann zugleich meine
Vorfreude kaum verbergen. Vor fast genau einem Jahr öffneten sich für mich die
Türen des Terminals nach 3 Monaten Asien. Liebevoll und unter Tränen der Freude
wurde ich von meine Liebsten empfangen.
Im Flughafengetümmel lasse ich mich von meinen Erinnerungen
treiben. Neben mir Menschen, die sich in die Arme fallen, sich küssen, zusammen
weinen, spüren, wieder vereint zu sein.
Und gleich soll es mir genauso gehen. Nach fast einem Jahr soll eine meiner
besten Reisebekanntschaften aus meiner Zeit in Asien landen: AJ, eine junge New
Yorkerin, die das Leben liebt und gerne lacht. Sie ist so ganz natürlich sie
selbst, manchmal tollpatschig, immer ehrlich, immer offenkundig an Jedem und
Allem interessiert.
Wie wird unser Wiedersehen wohl aussehen? Was wird uns erwarten?
Ich blicke ein weiteres Mal sehnsüchtig auf die
Anzeigetafel. Eine weitere Stunde Verspätung. Ich denke über AJ und unsere
Freundschaft nach.
Zu gerne erinnere ich mich an unser erstes Kennenlernen zurück. Es war eine ganz besondere Begegnung. Mit anderen Freiwilligen verbrachten wir unseren ersten Abend in Chiang Mai auf einem der wundervollen Märkte. Künstler der ganzen Stadt trafen sich hier um ihre Kunstwerke an den Mann zu bringen. Der Duft von thailändischem Essen, die Livemusik im Hintergrund und die vielen verschiedenen Künstler schafften eine ganz eigene Atmosphäre. Fasziniert von den fremden Eindrücken, riss mich AJ plötzlich mit den schiefen Klängen einer Ukulele aus den Gedanken. Sie konnte nicht Gitarre spielen und auch nicht Singen. Da stand sie nun, musizierte, lachte und fragte mich wie ich die Ukulele denn fände und ob ich nicht auch mit ihr spielen wollen würde. Ich lies mich von ihr mitreißen. Wir probierten uns durch den ganzen Laden. So richtig verstanden habe ich nicht, warum man sich eine Ukulele aus Thailand nach Amerika mitnehmen wollte. Es muss nicht immer alles Sinn machen, um Spaß zu machen, meinte AJ zu mir. So tanzten wir noch den ganzen Abend lebensfroh über den Markt und ließen uns vom Nachtleben treiben. Zwar ohne Ukulele, aber mit dem Gefühl, den Beginn einer Freundschaft gefunden zu haben. Vor fast genau einem Jahr feierten
wir dann meinen Geburtstag mit Singha Bier
und Pizza aus dem Wok. Weihnachten zelebrierten wir unter Palmen mit Plätzchen
aus der Heimat. Es war die beste Zeit meines bisherigen Lebens.
Auch wenn wir uns nicht täglich sehen und wenn wir wissen,
dass ein Wiedersehen nach nur fast einem Jahr über diese Distanz nicht selbstverständlich
ist, so wissen wir doch, dass unsere Freundschaft etwas ganz Besonderes ist und
wir immer aufeinander zählen können. Wir haben uns unter besonderen Umständen
kennengelernt. Eine Begegnung, wie es das Schicksal wollte. Wir fühlten uns miteinander
verbunden. Auf derselben Wellenlänge getragen. Ich war zu Beginn die
Vernünftige, AJ das pure Leben. So blieb die Ukulele auf meinen Rat in
Thailand, unserer peinlicher Auftritt an jenem Abend aber für immer in unserer
Erinnerung.
12:00 Uhr: Die Türen des Terminals öffnen sich. Hinaus
strömt eine ganze Menge an unterschiedlichen Menschen. Inmitten der Menge eine
kleine New Yorkerin mit viel Gepäck und einem Strahlen im Gesicht. Ich spüre
unsere unveränderte Verbundenheit in unserer langen, innigen Umarmung inmitten
des Flughafengetümmels, inmitten all der unvergesslichen Erinnerungen. Seit
wenigen Tagen ist AJ wieder in Amerika und wir fühlen uns noch immer verbunden.
Und wer weiß,
vielleicht geben wir eines Tages tatsächlich noch ein Ukulele-Konzert als Zeichen unserer Freundschaft.
Text: Laura Schurer
Foto: Yunus Hutterer

Michael Hopfs große Leidenschaften sind das Fotografieren und das Reisen. Am liebsten fotografiert er auf seinen Reisen und daheim in München ungewöhnliche Momente, die inszeniert wirken und doch echt sind.
Michael Hopf, 22, sitzt in seiner Mittagspause mit seinen Kommilitonen auf dem Dach der Fresenius Hochschule in München. Die Sonne scheint und der Himmel ist fast wolkenlos. Nur eine einsame Wolke, wie aus weißer Watte, schwebt über einen Schornstein des roten Backsteingebäudes. „Ein Augenblick, der echt ist, aber inszeniert wirkt“, sagt Michael. Besonders ungewöhnliche Momente möchte er mit seiner Kamera einfangen, die daran erinnern sollen, dass „es noch mehr gibt als den grauen Alltag“. Geboren und aufgewachsen in Neuburg an der Donau, zog Michael 2013 zu Beginn seines Fotodesign-Studiums nach München. Doch obwohl er die Stadt wegen ihrer Gemütlichkeit und Ordnung liebt, fehlt ihm oft ein wenig Chaos. Die Lebendigkeit von Thailand zum Beispiel, ein Land in das es ihn immer wieder zieht. „Mein Hauptlebensziel ist es, diesen Planeten zu sehen“, sagt Michael. Im Frühjahr war er in Australien. Davor in China, Südostasien und in Nordamerika. Von jedem Abenteuer bringt er Eindrücke mit. Für seine nächste große Reise spart er schon. Es soll nach Japan gehen.
Von: Stefanie Witterauf

Anika Landsteiner ist eine junge Schauspielerin. In diesem Beruf
versucht sie sich gerade zu etablieren. In ihrer Freizeit schreibt sie
einen Blog. „Als Schauspielerin schlüpfe ich immer in Rollen, beim
Schreiben meines Blogs bin ich dagegen ganz ich selbst“, sagt sie.
Am liebsten denkt Ani an Vergangenes. An Schönes, was
sie einmal erlebt hat. Wie es war, in einem Café zu sitzen, in einer
anderen Stadt, oder an einen einzelnen Kuss. Oft ist es nur ein feiner
Gedanke, um den herum sie dann eine der kleinen Geschichten spinnt, die
man seit einigen Monaten auf ihrem Blog www.anidenkt.blogspot.com lesen kann.
Anika Landsteiner, wie Ani vollständig heißt, ist Schauspielerin.
Nach ihrem Abitur hat die 24-Jährige eine Schauspielausbildung in
München gemacht. „Dass ich Schauspielerin werden wollte, stand schon
immer fest“, sagt Anika, „einen Plan B habe ich nicht.“ Hätte sie einen
Plan B, sagt sie, würde sie ja schon davon ausgehen, dass Plan A nicht
klappen könnte. Und: Es könnte funktionieren. Vor kurzem, am Ende eines
für Anika turbulenten Jahres, hat sie eine Agentur gefunden, die ihr
Kontakte zu großen Projekten vermitteln kann. „Es geht jetzt in die
Richtung, dass ich von meiner Schauspielerei leben kann.“ Bisher war das
gar nicht so leicht. Die Zeit nach ihrer Ausbildung füllten
hauptsächlich Bewerbungsschreiben und Agenturabsagen. Das sei zwar
frustrierend gewesen, aber nur auf Premierenfeiern zu gehen, um Kontakte
zu knüpfen, sei nicht ihre Art.
“Ich habe es nicht einmal übers Herz gebracht, als ich Marcus H.
Rosenmüller getroffen habe, zu sagen, dass ich Schauspielerin bin.“ Also
setzte sie sich an den Computer und schrieb Bewerbungen. Zwei Jahre
dauert es im Schnitt, um als Schauspieler Fuß zu fassen. Der Markt ist
überschwemmt, gerade was junge Frauenrollen betrifft. Doch Anika sieht
der Zukunft optimistisch entgegen.
Die Ideen ihrer hübschen Blog-Kolumnen kommen Anika im Alltag: Es
sind kleine Erlebnisse, Gedanken und Gefühle, die sie hierzu
inspirieren. Um diese Bausteine herum errichtet sie dann eine
Geschichte. „Ich weiß nie, worauf es hinauslaufen wird, wichtig sind mir
nur ein Rahmen und der rote Faden.“ Und der Humor. Ihre Leser sollen
schmunzeln, wünscht sie sich: „Das ist mein Anspruch, schon deswegen,
weil es schwierig ist, witzig zu sein.“
Anika sieht ihren Blog als Teil ihres Berufs, sie möchte Schreiben
und Spielen nicht streng trennen, gerade weil beides sich gegenseitig so
gut ergänzt. Zum einen als unterschiedliche Möglichkeiten
künstlerischen Ausdrucks, zum anderen aber auch als Ausgleich: „Als
Schauspielerin schlüpfe ich immer in Rollen, beim Schreiben meines Blogs
bin ich dagegen ganz ich selbst.“
Von: Anna Sophia Hofmeister