
Eine der jüngsten Tätowiererinnen Münchens: Catharina Emilia Carvalho Réis Gruber, 22, liebt es schrill. Werbung für ihre Arbeit macht sie mit sich selbst – kaum ein Fleck ihrer Haut ist mehr unbemalt
Ein menschliches Herz mit Flügeln – auf ihrer Brust. Das war Cats erstes Tattoo. Zwei Monate nach ihrem 18. Geburtstag ließ sie sich das fast tellergroße Motiv stechen. „Vor meiner Mutter versteckte ich es, weil sie davon gar nichts hielt“, sagt Cat. „Bis es im Sommer zu heiß war.“ Da riss Cat die Bluse auf und zeigte ihrer brasilianischen Mutter das Motiv.
Das war vor vier Jahren. An ihrer Leidenschaft für Tattoos hat sich trotz mütterlichen Ärgernisses nichts geändert. Im Gegenteil: Ihr ganzer Körper ist inzwischen voll mit permanenten Hautbemalungen, von den Zehen bis zur Stirn. Über den Hals zieht sich ein Frauengesicht, die Handfläche schmückt eine Rose, ein Kussmund auf der Schulter; sogar im Gesicht, neben ihrem rechten Auge befinden sich die Buchstaben „c/s“ – Kurzform für Con Safos, was „Mit Respekt“ heißt. Jetzt, mit 22 Jahren, ist schon fast kein Platz mehr auf Cats Körper für ein neues Tattoo.
Freitagabend um 23 Uhr, normale Arbeitszeit für eine Tätowiererin. Meistens kommen die Kunden erst nachmittags, oft dauert ein Motiv bis zu acht Stunden. Cat, die mit vollem Namen Catharina Emilia Carvalho Réis Gruber heißt, steht vor dem Identity-Tattoo-Laden in der Clemensstraße; sie raucht, hat einen Drink in der Hand und unterhält sich mit dem Kunden Dave, dem sie vor zwei Tagen ihr bisher aufwendigstes Tattoo gestochen hat – bis ein Uhr nachts saß sie daran. Dave krempelt stolz seinen Ärmel hoch: Das Motiv ist noch durch eine Folie bedeckt, unter der sich die überschüssige, herausgelaufene Farbe wie in einer Tüte sammelt.
Ihr erstes Piercing stach
sie sich mit 15 Jahren
selbst in die Nasenwand
Cat ist in Brasilien aufgewachsen und kam mit zehn nach Deutschland. In ihrer Jugend interessiert sie sich mehr und mehr für Körperkunst. Die Phase der Piercings hatte sie bereits hinter sich gebracht. Das erste stach sie sich mit 15 selbst in die Nasenwand. „Zwischenzeitlich hatte ich zehn Piercings im Gesicht“, sagt Cat und zeigt auf die Stellen rund um den Mund, wo man noch kleine Narben sieht. Die meisten hat sie wieder herausgenommen – weil man sie eben entfernen kann. Anders mit den Tattoos, die bleiben. Jemals eines bereut? „Klar“, sagt Cat. Einige hat sie bereits übermalt und aus alten Motiven neue gemacht. Bei anderen Tattoos, die sie sich selbst gestochen hat, etwa an den Fingern, ist die Farbe verlaufen. Da kann man nichts mehr machen. Einmal hat sie versucht, Tattoos mit einer speziellen Elektrotechnik zu entfernen. „Nie wieder“, sagt Cat. „Es hat wehgetan und ich habe richtige Narben bekommen.“
Cats Stil ist insgesamt exzentrisch, wie Hunderte Fotos im Internet dokumentieren. Für ihr Aussehen und Styling investiert sie morgens eine halbe Stunde. An diesem Tag trägt sie riesengroße grüne Ohrringe, eine Blumen-Hose, zwei Krokodile, die sich beißen, sind als Kette um ihren Hals gewickelt, lange bunte Fingernägel. Auf ihren Fotos sind auch türkisblaue Kontaktlinsen, blau-pinke Augenbrauen, ständig neue Haarfarben wichtiger Teil der Inszenierung. Das einzig Normale: der schwarze Pulli.

Besonders gerne tätowiert sich Cat selbst: Auf den Oberschenkel hat sie sich eine Lotusblüte gestochen. Wieso sie so schrill ist, kann sie sich selbst nicht erklären: „Das hat die Zeit so mit sich gebracht.“ Und dann fügt sie hinzu: „Es kann sein, dass es an der strengen Erziehung lag.“ Von ihrer Mutter wurde Cat inzwischen rausgeworfen – nachdem diese das bisher riesigste Tattoo an Cat entdeckte, das sich vom Rücken bis zum Gesäß zieht. „Als ich ausgezogen bin, hat sich unser Verhältnis verbessert“, sagt Cat. Und es hat ihr geholfen, ihren Weg zu finden. Cat hat kein Abitur gemacht, kein Studium angefangen. Für sie gab es nur eine Wahl: Sie wollte Tätowiererin werden.
Wie wird man Tätowierer? Es gibt keine Zugangsregeln für den Beruf, erklärt Maik Frey, Verbandssprecher der Deutschen Organisierten Tätowierer. „Jeder kann sich Tätowierer nennen.“ Bis man das Handwerk beherrscht, sollte man etwa zwei bis drei Jahre zuschauen und üben, empfiehlt er. Frey beobachtet, dass immer mehr Frauen in den Beruf gehen, er schätzt den Anteil auf ein Drittel. „Vor 20 Jahren kannte ich nur eine Tätowiererin“, sagt Frey.
Bei Cat hat es drei Anläufe gebraucht, bis sie ein Tattoo-Studio gefunden hat, in dem es ihr gefällt. Inzwischen hat Cat einen wachsenden Kundenstamm. Sie hat sich auf Frauengesichter spezialisiert. Cat wird von Modeheften inspiriert – und von Barbies. Ist das nicht ein sehr klischeehaftes Schönheitsideal? „Schon“, sagt Cat, „aber in Brasilien hatten wir nicht viel Geld. Daher waren Barbies für mich ein Wohlstandssymbol.“
Tattoos schienen eine Zeit lang uncool zu sein. Doch im Netz erlebt die Tattoo-Szene eine neue Blütezeit. Es wird fotografiert, geteilt und geliked, was das Zeug hält. Menschen mit vielen Tattoos werden zu kleinen Internetgrößen stilisiert.
So wie Cat. Durch die sozialen Netzwerke schwirren Tausende Bilder ihrer bemalten Haut, mit meist mehreren Hundert Likes darunter, auf der Foto- und Videoplattform Instagram (instagram.com/realcatink) folgen ihr mehr als 13 000 Nutzer.

Das Großprojekt: Cats Rücken. Es steht noch aus. Von dem Motiv hat sie bereits eine genaue Vorstellung. Derzeit drückt sich Cat aber vor der nächsten Sitzung. Der Rücken ist ein empfindliches Teil. „Er tut am meisten weh“, sagt sie. Es entsteht gerade ein Tiger, auch ein tibetanischer Schädel ist mit in der Skizze. Bisher stehen aber nur die Außenlinien – bis das Bild ausgemalt ist, dauert es noch. Dazu kommen soll auch ein typischer Tattoo-Spruch: „Only God Can Judge Me“, ein Song von dem Rapper Tupac. Cat wird den Satz in abgewandelter Form anbringen: „Only I Can Judge God“.
Caroline von Eichhorn
Foto: Cat



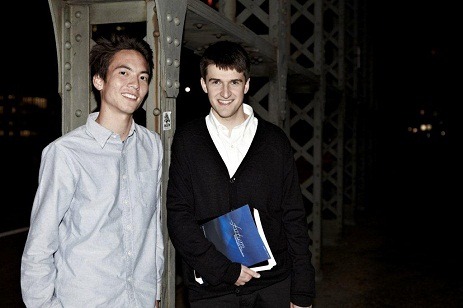


 Architekt Markus Weinig (links) und Physiker Niko Wintergerst
Architekt Markus Weinig (links) und Physiker Niko Wintergerst
