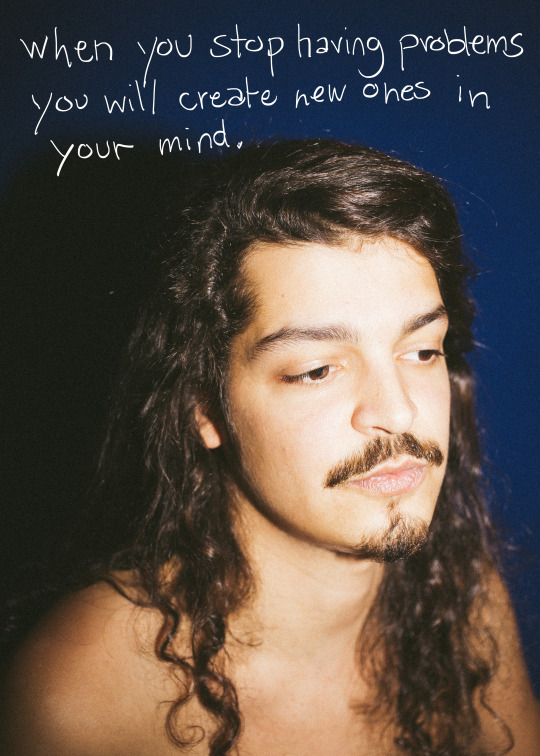Ohne ein Wort Spanisch zu können ist Simon Kreuzer, 19, für ein halbes Jahr nach Ecuador gegangen. Er machte einen musikalischen Freiwilligendienst, den der Verein Musiker ohne Grenzen anbietet. An der Musikschule „Clave de Sur“ in Guayaquil unterrichtete er Trompete und Klavier – seine Schüler waren vor allem Kinder und Jugendliche. Nun ist er wieder zurück in München.
SZ: Wie sehr unterscheidet sich der Stellenwert von Musik in Ecuador von dem in Deutschland?
Simon Kreuzer: Generell wird sehr, sehr viel zu Musik getanzt. Wenn man dort auf eine Hausparty geht, dann läuft eigentlich die ganze Nacht Musik und es wird durchgetanzt. Ohne Pause. Hier in Deutschland wird natürlich auch getanzt, aber wenn ich mit meinen Freunden auf eine Party gehe, gibt es fast nur Partytanzen. Die Mehrheit sitzt dann aber doch rum, plaudert oder spielt Trinkspiele.
Und wie ist das tagsüber?
Die Ecuadorianer hören sehr oft und sehr laut Musik. Fast jedes Haus hat eine große Box, hat die dann laufen und beschallt die ganze Straße. Was ich eher selten gehört habe, war, dass jemand ruhig, entspannt und leise Musik gehört hat. Der Musik zugehört hat, sage ich mal. Es war so ein bisschen ein Krach, der natürlich auf eine Party gut passt, aber tagsüber war das auch nervig.
Du hast vor Ort ja selbst Musik gemacht. Wie war das Unterrichten?
Das läuft dort ganz anders ab. Ich konnte mir nicht sicher sein, ob mein Schüler kommt oder nicht. Es passierte viel öfter, dass ein Schüler mal nicht kommt und auch nicht entschuldigt wird. Das ist einfach die Kultur dort. Der Musikunterricht war schon in etwa so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Aber?
Als ich angekommen bin, gab es leider sehr wenige Gruppenensembles, was ich ein bisschen schade fand. Das war das, worauf ich mich am Anfang am meisten gefreut hatte, und das war enttäuschend. Gruppen zu unterrichten macht doch am meisten Spaß. Und das habe ich versucht, wieder aufzubauen. Das hat auch funktioniert. Am Schluss gab es wieder Ensembles, unter anderem auch eine Bläsergruppe und eine Jazzband.
Warum unterrichten Freiwillige dort?
Sie sind wahnsinnig wichtig für das Projekt, weil es eigentlich komplett auf Freiwilligen beruht. Sie haben dort angefangen, Musik zu unterrichten. Mittlerweile gibt es dort auch ecuadorianische Lehrer, aber letztendlich kommt der Input von den Freiwilligen aus Deutschland. Sie haben bessere Möglichkeiten, ein Instrument zu erlernen und wollen das weitergeben. Was wir dort machen, ist, den Schülern zu vermitteln, wie man selbst übt, weitergibt und lernt. Wenn wir nach einem halben Jahr wieder gehen, hoffen wir, dass sie dann nicht aufhören, Unterricht zu nehmen.
Warum ist es so wichtig, dass sie mit dem Musizieren weitermachen?
Das Viertel, wo die Musikschule in Guayaquil war, ist ein ärmeres Viertel. Dort gab es früher viel Kriminalität – also, was Banden angeht, es wurde viel geschossen. Es wird auch noch viel geraubt, es gibt viele Drogensüchtige. Die Drogenszene ist teilweise nicht so gut und Mit diesem Projekt sollen den Kindern und Jugendliche andere Perspektiven geschaffen werden, damit sich nicht mehr auf der Straße rumhängen. Hat jetzt auch gut funktioniert in meinem halben Jahr.
Und wie gefährlich war es?
Bandenkriminalität habe ich nicht erlebt, mir wurde auch nichts geraubt. Ich habe von meiner Mentorin vor der Reise gehört, dass die ganzen Straßen nicht geteert seien. Aber als ich jetzt dort war, waren nahezu alle schon geteert. Wenn eine Straße geteert ist, ist das ein Zeichen dafür, dass es schon sicherer ist. Ich denke schon, dass die Musikschule etwas geholfen hat. Es gibt andere Teile, wo es noch mehr Kriminalität gibt. Um die Musikschule herum ist es deutlich besser geworden.
Was ist sonst noch anders am Leben in Ecuador?
Von der Einstellung her ist man sehr spontan, aber auch nicht sehr zuverlässig. Wenn man sagt, man trifft sich um die oder die Uhrzeit, dann kann man davon ausgehen, dass man sich eine halbe Stunde später trifft. Das ist wirklich eine komplett andere Kultur. Wir haben es in Deutschland ja verhältnismäßig luxuriös. Das merkt man erst, wenn man dort war. Ich habe auch in einem ärmeren Viertel gewohnt, wo man nicht so viel Geld hatte. Es gab Familien, die gerne ins Kino gegangen wäre, aber sie hatten kein Geld, um ins Kino zu gehen.
Merkt man, dass die Familien arm sind?
Nein, mich hat echt beeindruckt, dass man es ihnen gar nicht anmerkt, wie arm sie sind. Man merkt das erst, wenn man etwas machen möchte. Sie sind tatsächlich glücklich, sprühen vor Lebensfreude und haben immer Spaß. Viel mehr, als ich es aus Deutschland kenne. Wenn man auf eine Party geht, wird die ganze Nacht getanzt. Gesamt betrachtet ist man fröhlicher dort, obwohl es ihnen verhältnismäßig gar nicht so gut geht. Nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie uns.
Was hast du daraus gelernt?
Dass man gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein. Und dass man mit weniger glücklicher ist.
Interview: Lena Schnelle
Foto: privat