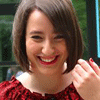„Young Chinese Dogs“, die Band des Jahres der Junge-Leute-Seite, hat mit ihrem akustischen Folk-Pop plötzlich Erfolg – und ein Problem: Wirkt Lagerfeuermusik auch vor 1000 Menschen? Jetzt gehen die drei Musiker auf eine Sofa-Tour. Ein Interview.
Angefangen hat bei Young Chinese Dogs alles mit der Idee, nur Instrumente zu spielen, die jeder tragen kann. Seit vergangenem Jahr wächst der Erfolg für Nick Reitmeier, Oliver Anders Hendriksson und Birte Hanusrichter – und wie zuletzt bei einem Festival muss sich die „Band des Jahres“ der Junge-Leute-Seite eine Frage stellen: Wirkt Lagerfeuermusik auch vor 1000 Menschen? Gitarrist Nick Reitmeier, 26, sucht Antworten.
SZ: Man kann sagen, 2013 war euer Jahr: Vertrag bei Grand Hotel van Cleef, neues Album, Band des Jahres 2013 bei der SZ – was lief denn plötzlich anders als die Jahre davor?
Nick Reitmeier: Für mich persönlich waren die Jahren davor auch schön.
Bitte?
Okay, 2013 sind viele richtig große Sachen passiert. Wir haben unser Album aufgenommen und veröffentlicht. Anfang des Jahres haben wir eine Tour gespielt, im Herbst waren wir drei Wochen am Stück unterwegs, unter anderem auch mit Young Rebel Set.
Trotzdem: Euch gibt es ja schon länger. Wieso war gerade 2013 so erfolgreich?
Schwierig zu sagen. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass wir davor weniger erfolgreich waren. Wir hatten gefühlt schon nach zwei Wochen zehn Songs geschrieben – und im ersten Jahr schon 40 Konzerte gespielt. Natürlich waren die Auftritte damals nicht vor 300 Leuten, sondern vielleicht vor 30.
Das macht aber schon einen Unterschied.
Erfolg ist ja immer etwas Subjektives. 2012 haben wir gespielt wie die Blöden. 2013 kam aber erst die Außenwirkung, weil wir in den Jahren davor einen Grundstein gelegt hatten. Bei den ersten Konzerten kennt dich natürlich kein Schwein – und nach einem Jahr veranstaltest du in derselben Location ein Konzert, und dann ist es plötzlich voll.
Baut sich also alles langsam auf?
Nur weil kein Album erscheint, heißt das ja nicht, dass wir nichts getan haben. Wir sind trotzdem die ganze Zeit auf Tour gewesen. Gerade ist die neue Single zur Sofa-Tour erschienen, ein cooles Video kommt raus. Das passiert ja auch nicht alles über Nacht.
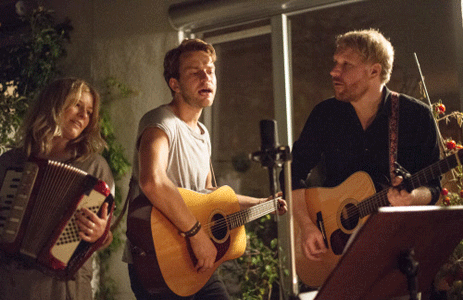
Wie kommt es zu dieser Sofa-Tour?
Nachdem Emma bei der Junge-Leute-Seite das Wohnzimmerkonzert mit uns gewonnen hat, war klar, dass wir das auch mal als Tour machen. Und im Prinzip ist das auch eine Rückkehr zu unseren Anfängen – Straßenmusik, ohne großen Aufwand ein intimes Konzert spielen.
Was genießt ihr denn mehr? Intime Shows oder Konzerte vor 1000 Zuschauern?
Cool ist beides. Ist aber beides was ganz anderes. Ich möchte auf die großen Shows nicht verzichten. Es ist ein tolles Gefühl, auf einer großen Bühne rumzulaufen. Aber auch kleine Shows sind spannend, wenn die Nase in der ersten Reihe gerade mal 50 Zentimeter entfernt ist. Nervöser bin ich bei den kleineren Sachen.
Angefangen hat bei euch ja alles mit der Idee, nur Instrumente zu spielen, die jeder tragen kann – geht das mit dem wachsenden Erfolg auch? Wirkt Lagerfeuermusik auch vor 1000 Menschen?
Ich bilde mir ein, dass das funktioniert. Es ist eher die Frage, ob man es sich traut. Ich hatte auf der Bühne nie das Gefühl, dass wir zu wenige Instrumente dabei hatten. Ich hatte nie das Gefühl, dass es nicht fett genug oder nicht laut genug ist.
Jetzt wo alles größer ist: Wollt ihr dann auch als Band größer werden? Bislang verzichtet ihr auf ein richtiges Schlagzeug.
Nur weil es mehr wird, heißt es nicht, dass es besser wird. Zehn Kilo Pommes machen das Essen auch nicht besser. Es kommt auf Zutaten und Mischungsverhältnis an. Das Ziel soll sein, besser zu werden, nicht größer. Ein Song muss mit einer Gitarre und einer Stimme gut sein. Wenn mich dann ein Song nicht umhaut, ist er höchstens mittelmäßig. Und mich interessieren keine mittelmäßigen Songs.
Mit Mumford & Sons und anderen Bands wurde in den vergangenen Jahren ein Folk-Hype ausgelöst. Ist euer Erfolg unabhängig davon zu sehen?
Schwer zu sagen, ob es davon abhängig ist. Ich habe Mumford & Sons erst kennen gelernt, als Leute uns in Interviews mit denen verglichen und gesagt haben, wir hören uns so an wie die. Keiner von uns ist aber ein Folk-Experte. Und: Wir haben wenig Ähnlichkeit mit Mumford & Sons.
Inwiefern?
Mumford & Sons sind klassischer. Wir kommen mehr aus der Punkrock-Ecke, auch wenn man das nicht mehr hört.
Wenn ihr alle musikalisch eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, wieso macht ihr dann Folk-Musik?
Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Folkband sind. Wir machen einfach Musik zusammen und das klingt halt so. Das kommt vielleicht auch daher, dass wir nie einen Proberaum hatten. Wir haben mehr in der Küche oder in der U-Bahn geprobt. Aber wir suchen gerade ernsthaft einen Proberaum.
Erfolg ist schnelllebig – was macht ihr, wenn der Folk-Hype wieder vorbei ist?
Nachdem wir uns nie als Folk-Band gesehen haben, glaube ich auch nicht, dass wir so stark von diesem Trend abhängig sind.
Wenn ihr euch nicht als Folk-Band seht, was seid ihr denn dann?
Wir sind Young Chinese Dogs. Wir spielen akustischen Pop, vielleicht sind wir eine akustische Folk-Band.
Das wart ihr auch schon 2011 – was hat sich verändert?
Anfang 2011 war die Birte noch nicht dabei. Wir haben jetzt eine verdammt gute Frontfrau. Und wir haben verdammt viel gelernt.
Gelernt?
Wir machen immer alles selbst. Vom Booking bis hin zur Entscheidung, wie viele saubere T-Shirts packe ich mir auf die Tour ein. Wir haben nach wie vor das Glück, dass wir keinem die Kontrolle abgeben müssen wie größere Bands. Es macht am Ende glücklicher, wenn man alles selbst macht. Auch wenn es manchmal vielleicht leichter wäre.
Was macht ihr denn alles?
Wir überlegen etwa, welches Video wir machen. Die Band kocht auch für die Hauptdarsteller und fahren das Essen zum Set. Es ist nicht so, dass unser Management sagt, ihr müsst jetzt ein Video machen und los. Auf Tour ist es genauso. Uns sagt niemand, an dem und dem Tag holt euch der Nightliner ab. Wir buchen selbst Hotels, Autos und koordinieren die Zeiten.
Und wie soll es weitergehen?
Wir wollen uns neuen Herausforderungen stellen. Gerade haben wir Filmmusik aufgenommen – für den ZDF-Film „Zweimal zweites Leben“ mit Heike Makatsch und Benno Fürmann.
Wie ist das ZDF auf euch gekommen?
Wir haben mal bei einem Fest der Produktionsfirma gespielt.
Nach ein paar Monaten haben sie gefragt, ob wir die Filmmusik machen können.
So einfach kann es also manchmal gehen.
Uns hat nie jemand bei der Hand genommen und gesagt, was wir machen sollen, um besser anzukommen. Wir haben alles selbst ausprobiert, wir hatten auch Songs, die nicht so gut angekommen sind. Das mussten wir alles auf die harte Tour lernen.
Interview: Gabriella Silvestri